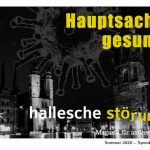Vom 3.02. bis zum 16.02. zeigten die Parallelausstellungen „Altkleider – do not wear“ von der Stipendiatin Aurelia Becker und „Made in_ Woher kommt meine Kleidung?“ von Nadja Winter und Isabelle Selwat in der Großen-Ulrich-Str. 13, dem ehemaligen Xenos-Kaufhaus, die Herkunft unserer neuen Kleider und das Schicksal unserer alten – mit Blick auf die sozialen und ökologischen Konsequenzen.
Im Teil „Made in_“ Woher kommt unsere Kleidung?“ ging es um die Rohstoffe und ihre Verarbeitung. Natur- und Kunstfasern werden aufwändig und unter erheblichen Umweltbelastungen hergestellt und verarbeitet. Der Baumwollanbau etwa ist ein Ressourcenfresser und braucht tonnenweise Gifte, um die Pflanze gewinnbringend anbauen zu können. Chemiefasern wie Polyamid werden aus Erdöl hergestellt und sind ebenso wenig abbaubar wie alle anderen Plastikprodukte.
Die beim Waschen gelösten Fasern gelangen mehr oder weniger ungehindert in Form von Mikroplastik überall hin – in Fließgewässer und Meere und schließlich ins Trinkwasser. Das Färben der Materialien für unsere Kleidung geschieht oft in China. Dort fließen die hochgiftigen Abwässer in Flüsse und Seen und verseuchen das Grundwasser. Was im Stoff bleibt, tragen wir auf der Haut und, wenn es sich schließlich löst, in unserem Blut. Man konnte vor Ort selbst Stoff färben, um zu erleben, wie langwierig das ist.
Wissen wir das alles schon? Ja, sicher ...
 Angesichts dessen: Fragen wir bei jedem Kleidungsstück, oft genug unter Sklaverei ähnlichen Zuständen genäht und hier billig verkauft, ob wir es wirklich brauchen? Das nicht wirklich Gebrauchte nämlich wandert schnell in die Altkleider, die den anderen Teil der Ausstellung bestimmten. Kleine Berge davon lagen davon herum und rochen charakteristisch nach Muff. Die Prinzipien der Sortierung und Weiterverwertung wurden dargestellt, verbunden mit dem Appell, doch lieber zu reparieren und aufzuwerten, als schnell wegzuwerfen. Denn eine wirklich gute Verwertung gibt es eigentlich nicht. Zu viel von unseren Altkleidern wandert etwa nach Afrika, liegt dort auf den Märkten herum und zerstört die einheimische Bekleidungsindustrie.
Angesichts dessen: Fragen wir bei jedem Kleidungsstück, oft genug unter Sklaverei ähnlichen Zuständen genäht und hier billig verkauft, ob wir es wirklich brauchen? Das nicht wirklich Gebrauchte nämlich wandert schnell in die Altkleider, die den anderen Teil der Ausstellung bestimmten. Kleine Berge davon lagen davon herum und rochen charakteristisch nach Muff. Die Prinzipien der Sortierung und Weiterverwertung wurden dargestellt, verbunden mit dem Appell, doch lieber zu reparieren und aufzuwerten, als schnell wegzuwerfen. Denn eine wirklich gute Verwertung gibt es eigentlich nicht. Zu viel von unseren Altkleidern wandert etwa nach Afrika, liegt dort auf den Märkten herum und zerstört die einheimische Bekleidungsindustrie.
Wissen wir alles schon? Ja, sicher (das ist ja das Schlimme). Handeln wir danach? Na ja ... Vielleicht. Manchmal. Und überhaupt, Schuld ist die Mode. Und die Industrie natürlich.
Genau deshalb sind solche Ausstellungen nützlich. Sie holen das Thema zu uns, in unser Land, in unsere Schränke, auf unsere Haut. In gut ausstellungspädagogischer Manier waren allerlei Mitmachstationen angeboten, z. B. das Sammeln von Baumwolle unter Zeitdruck. Man merkt sich etwas besser, was man handelnd oder mit mehreren Sinnen erfährt. Hoffentlich.

Zur Ausstellung gehörten Interviews mit Vertreter*inen der Recyclingbranche